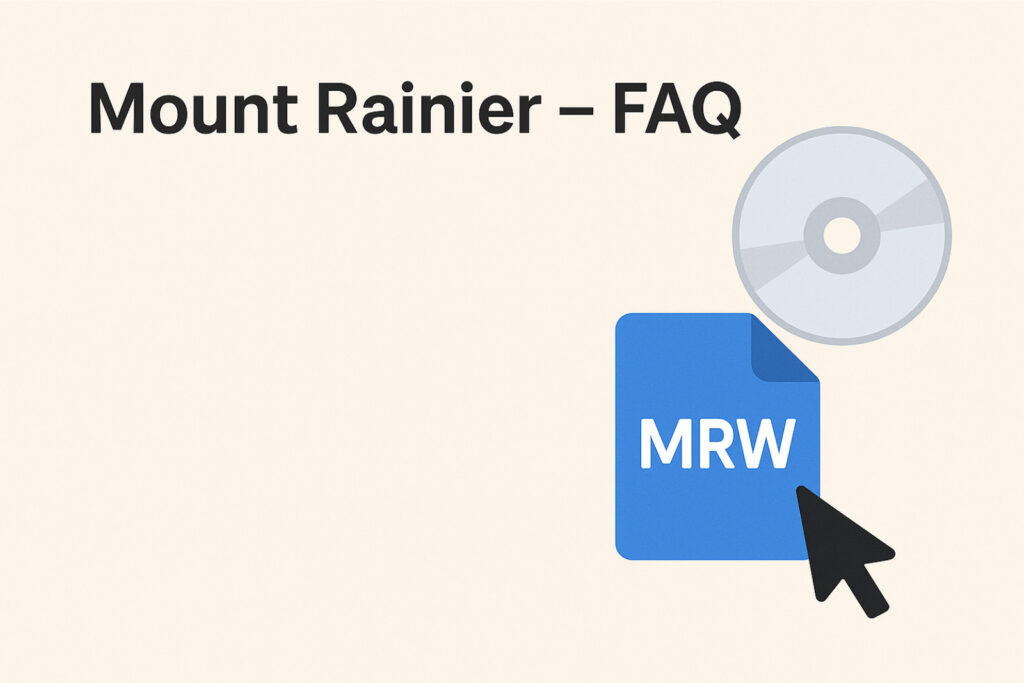Der Begriff „Server“ hat, je nach Bereich und Einsatzzweck, unterschiedliche Bedeutungen. Und fragt man zehn verschiedene Experten, wird man vermutlich auch zehn verschiedene Antworten erhalten. Denn der Begriff kann sowohl für die Hardware selbst, als auch für verschiedene Softwarelösungen verwendet werden.
Ein bekannter Einsatz ist beispielsweise der Mail-Server, über den die gesamte digitale Korrespondenz eines Unternehmens abgewickelt werden kann. Daneben gibt es beispielsweise den Einsatz als Datenserver, als Webserver, Datenbankserver, Gamingserver und vielen mehr. Wird ein Server nur für eine bestimmte Aufgabe genutzt, wird oft der Begriff „dedicated Server“ benutzt (dedicated = „dediziert“, „gewidmet“). Da in der Praxis ein Gerät aber meist mehrere Aufgaben übernimmt, also mehrere Serverprogramme auf ihm laufen, hat der Begriff Server für den Rechner als Ganzes etabliert.
Gemeinsam haben diese Geräte eins: Sie alle stellen einen Service zur Verfügung, auf denen nicht nur ein, sondern mehrere (10, 100 oder sogar mehr) Nutzer gleichzeitig zugreifen können. Damit ist ein Server eine zentrale Instanz, die je nach Server-Typ die erforderlichen Programme und Daten bereitstellt.

Das Client-Server-Konzept
Wenn man sich die historische Entwicklung des Begriffs Server anschaut, erkennt man noch heute das zu Grunde liegende Kernmodell, das sich dahinter verbirgt: das sogenannte Client-Server-Modell. Hierbei greift eine größere Zahl an sogenannten Clients („Kunden“) auf einen zentrale Computer (Server = Diener) zu, der sämtliche Anfragen der angeschlossen Rechner bedient. Dabei muss der Server ständig aktiv und bereit sein, auf die Anfragen der Clients zu reagieren. Die Art der Anfrage und der Kommunikation (Datenaustausch) zwischen Client und Server wird in sogenannten Protokollen festgelegt.
Aus den oben genannten Punkten erkennt man bereits, welches wichtige Kriterium für die Performance, also die Leistungsfähigkeit eines Servers, sich aus der Art der Verwendung ergibt. Denn um einen flüssigen Austausch von Daten zwischen dem Server und den Clients zu gewährleisten, muss dessen Hardware ausreichend dimensioniert sein, damit er unter der zu erwartenden Last vieler dutzend (oder im Falle eines Webservers auch hundert) Anfragen pro Minute nicht zusammenbricht.
Um die benötigte Leistung und die dafür notwendige Hardware richtig einschätzen zu können, ist es also unbedingt nötig, den Verwendungszweck, die Anzahl der später laufenden Anwendungen, und vor allem die Anzahl der Clients zu kennen, die auf den Server zugreifen werden.
Was muss ich beim Serverkauf beachten?
Wie bereits oben beschrieben sind bei der Anschaffung eines Servers zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen. Die Art der späteren Verwendung durch die Menge an laufenden Programmen, die Anzahl der zugreifenden Clients, eventuelle Leistungsspitzen zu „Stoßzeiten“ und damit verbundene Leistungsreserven, sind nur ein paar, die es zu benennen gibt. Auch eventuelle Erweiterungsmöglichkeiten sollte man mit in Betracht ziehen.
Hat man all diese Punkte richtig beurteilt kann man einschätzen, welche Hardware der Server benötigen wird, um die geforderte Leistung zur Verfügung zu stellen. Dabei kommt es vor allem auf die passende Größe des Hauptspeichers (RAM), die ausreichende Dimensionierung der Speicherkomponenten (Festplatten, SSD-Speicher), die Anzahl und Leistung der Prozessoren und natürlich die Performance des Mainboards an.
Von Atom bis Xeon – der Prozessor
Als Faustregel gilt: je anspruchsvoller Ihre geplanten Anwendungen sind, desto leistungsfähiger sollte auch der Server-Prozessor sein. Und je mehr Anwendungen das zukünftige Gerät gleichzeitig verarbeiten soll, umso mehr sollte man auf die Anzahl der Prozessorkerne achten.
Prinzipiell bietet eine Intel-Atom-CPU sicherlich nicht genug Power für rechenintensive Anwendungen, wie beispielsweise Umfangreiche Datenbankabfragen von vielen Clients gleichzeitig. Falls Sie ganz sicher gehen wollen, dass der neue Rechner nicht schon nach kurzer Zeit schlapp macht, empfiehlt sich z.B. der Kauf eines aktuellen Xeon-Prozessors von Intel, der es so ziemlich mit jeder Anwendung aufnimmt. Sollen viele Anwender gleichzeitig auf den Server zugreifen, sollte man unter Umständen nicht nur auf die Geschwindigkeit und die Anzahl der Prozessorkerne, sondern auch auf die Anzahl der Prozessoren insgesamt achten. Der Hersteller Supermicro bietet dafür z.B. Systeme mit bis zu 8 Prozessoren für Racks an.
Von Gigabyte bis Terrabyte: der Arbeitsspeicher
Was für den Prozessor gilt, lässt sich mühelos auf den Arbeitsspeicher (RAM) übertragen. Auch hier gilt: Je rechenintensiver und datenlastiger die geplanten Anwendungen sind, desto mehr RAM sollte im Server verbaut sein. Und die Anwenderzahl sollten Sie dabei auch einplanen. 8 Gigabyte sind heutzutage absolutes Minimum für Server und auch in herkömmlichen Heimrechnern schon Standard. Je nach Anwendungsintensität können in Servern auch schnell 128 Gigabyte zur Verfügung stehen. Hochspezialisierte Systeme aus mehreren Racks für extrem intensive Anwendungen, z.B. in Rechenzentren, sprengen auch gern mal die Gigabyte Grenze.
Aber nicht nur die Größe des Arbeitsspeichers, auch dessen Geschwindigkeit spielt eine Rolle. Dabei gilt als Faustregel: neuere Speicherbausteine (z.B. DDR4 bzw. der kommende DDR5) basieren auf filigraneren Fertigungsprozessen und erlauben höhere Taktraten als „alte“ Speicher, was sich positiv auf die Leistung auswirkt.
SDD oder HDD: die Speicherkomponenten
Aus dem PC-Bereich bereits bekannt: Musik, Bilder, Videos und andere Medieninhalte sowie zugehörige Programme werden immer größer und größer nehmen immer mehr Speicher ein. Daher gehört im PC-Segment ein Terabyte an Speicherkapazität bereits zum Standard, mehr ist sicherlich auch nicht verkehrt. Und mithilfe verschiedener Cloud-Speicher Dienste wie Apples iCloud, Dropbox oder Microsoft OneDrive, etc. lässt sich die Speicherkapazität oft kostenlos erhöhen. Für datenintensive Anwendungen ist das aber noch keine Alternative.
Im Server-Bereich verhält es sich mit den Speicherkapazitäten ein wenig anders: hier wird die Client-Server-Architektur genutzt um große Datenmengen zu verwalten. Das bedeutet: beim Server selbst kommt es nicht so sehr auf den Speicher an, da hierfür eher entkoppelte Storage-Systeme wie NAS oder SAN genutzt werden. Diese Systeme sind mit dem Server verbunden, der wiederum den Datenaustausch zwischen dem Storage-System und den Clients regelt. Doch auch in diesen Storage Systemen kommen Festplatten zum Einsatz, die in sogenannten „Raids“, also Festplattenverbunden, zu gemeinsamen Datenspeichern zusammengeschlossen werden.
Spielt die Performance eher eine untergeordnete Rolle und geht es hauptsächlich um pure Speicherkapazität, werden nach wie vor die bekannten auf Magnettechnologie basierten SATA HDDs in besonders langlebigen, auf Dauernutzung ausgelegten Varianten angeboten. Bei hohen Performance-Anforderungen kommt man nicht mehr an den neueren, flashbasierten SSD Festplatten vorbei. Deren Technologie basiert nicht mehr auf dem mechanischen sondern elektronischen Speichern von Daten, was deutlich schnellere Transferraten erlaubt, allerdings auch deutlich teurer ist.
Egal für welche Form der Datenspeicher man sich entscheidet, gerade in großen Netzwerken sollte man von Anfang an auf ein ausreichend dimensioniertes Speichervolumen achten.
Lüfter, USV & mehr: die Peripherie
Je nach Einsatzgebiet empfiehlt sich neben der reinen Server-Anschaffung der Kauf weiterer Komponenten, die den geplanten Einsatz des Rechners verbessern können.
Sinnvoll können vor allem sogenannte USVs sein, also Geräte, die für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zuständig sind (im Englischen: UPS – uninterruptible power supply). Diese sorgen im Fall einer Störung der Stromversorgung von Servern dafür, dass der Server nicht sofort ausgeschaltet wird, sondern genügend Zeit für eventuelle Datenbackups bzw. das ordentliche Herunterfahren des Systems zur Verfügung steht. Eine dauerhafte Langzeit-Stromversorgung wird dadurch allerdings nicht gewährleistet, vielmehr sind die USVs als „Notakku“ und Überspannungsschutz zu verstehen.
Auch die Anschaffung zusätzlicher Gehäuse-, Prozessor- oder Grafikeinheiten Lüfter kann sinnvoll sein. Vor allem dann wenn damit zu rechnen ist, dass das System entweder auf sehr hohen Lasten laufen kann oder durch die Umgebungen einer hohen Temperatur ausgesetzt ist.
Tower oder Rack – das richtige Servergehäuse
Hat man die richtige Hardware ausgewählt wird schnell ersichtlich, ob für den geplanten Zweck ein normaler Tower-Server (also ein klassisches Turmgehäuse) ausreicht, oder ob man sich gleich für einen Rack-basierten Server entscheiden sollte. Dabei spielen der Platzbedarf und die Erweiterbarkeit eine wichtige Rolle.
Tower Server kommen meist in kleinen Firmen in einer klassischen Arbeitsplatz-Umgebung zum Einsatz. Rack-Server findet man dagegen eher in professionellen Umgebungen, beispielsweise in Rechenzentren, aber auch in größeren Unternehmen. Diese Server sind in ganzen Serverschränken modular in passenden Einschüben, den sogenannten „Racks“ untergebracht. Vorteil: durch die modulare Bauweise können Komponenten leichter ausgetauscht und erweitert werden, nehmen allerdings auch deutlich mehr Platz ein.
Exkurs: Bauhöhe von Rackservern
Denn ein Rack-Server wird in sogenannten Höheneinheiten (HE), Rack Units (RU) oder einfach nur Units (U) gemessen. 1U bzw. 1HE steht für eine Unit bzw. Höheneinheit. Deren Höhe entspricht genau 1,75 Zoll, also etwa 4,5 cm. Die meisten Rack-Server haben die Höhe 1HE bzw. 3 HE (ca. 13,5 cm). Da es Gehäuse mit über 40 Racks gibt, kann man sich gut deren Gesamtgröße vorstellen.
Die passende Server-Software
Nachdem die Hardware des neuen Serversystems zusammengestellt wurde, steht die nächste Entscheidung an: die passende Software. Auch hier gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das beginnt bereits beim Betriebssystem. Häufig werden Server mit Betriebssystemen von Microsoft (Microsoft Windows Server) betrieben, da diese die größte Kompatibilität zu anderen Programmen und Diensten aufweisen. Und mit den notwendigen Anwendungsprogrammen wie Microsoft Exchange (Mail-Software), dem neuen Office 365 oder SharePoint besitzt man eine Fülle möglicher Anwendungen.
Als weiteres wichtiges Betriebssystem muss Linux genannt werden, dass gerade im Serverbereich bekannter als seine Windows-Konkurrenten ist. Allerdings ist dieses System auch für Einsteiger oder Windows Umsteiger am Anfang schwerer zugänglich. Vorteile sind dagegen die im Wesentlichen kostenfreie Verfügbarkeit, der modulare Aufbau und die Sicherheit – Linux punktet mit verschiedenen Verschlüsselungsmöglichkeiten und einem umfangreichen Rechtesystem, das Fremdzugänge
Über die Autoren:
Das Redaktionsteam von Hardwarejournal.de besteht aus erfahrenen Technik-Fans und langjährigen Community-Mitgliedern der IT- und Hardware-Szene. Praxisnah berichten wir über aktuelle Entwicklungen rund um PC-Komponenten, Software-Trends sowie digitale Technologien. Dabei ist es unser Ziel, komplexe Inhalte verständlich aufzubereiten und praktische Tipps zu geben.